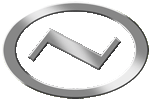Radwerk III
Gebläsehaus
Man betritt das Radwerksgelände auf einem Steg über den Vordernberger Bach und gelangt zum Eingang in den Zubau des eigentlichen Gebläsehauses. Über bzw. neben der Türe befinden sich Schlägel und Eisen sowie das Zeichen des RW III. Im Zubau geben Bilder und Tafeln Aufschluß über Geschichte und früheres Aussehen des Schmelzwerkes sowie über die Konstruktion des Gebläses.
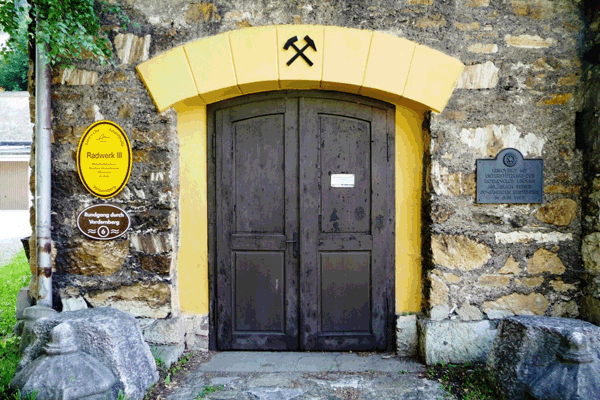
F. C. Weidmann beschrieb die ältere, von der Maschinenbauanstalt Ruffer in Breslau gelieferte Dampfmaschine 1854 wie folgt: "Die (stehende) Dampfmaschine, zu 24 Pferdekräften, wird indessen nur bei niederm Wasserstande in Tätigkeit gesetzt, arbeitet aber mit dem Wasser zugleich, wenn das Werk zu größeren Leistungen erhöhter Anstrengung bedarf ... Der Dampfkessel (mit einem Siederohr), sowie der Apparat der Lufterhitzung stehen auf der Hüttensohle, und zur Beheizung derselben werden Gase von der Gicht in starken, blechernen Röhren auf den Boden herabgeführt, sodaß, wenn die Öfen einmal in Hitze sind, kein weiterer Brennstoff mehr nöthig ist."
Der Ausbau der Gebläseanlage (stehende Dampfmaschine, Wasserrad und zwei Gebläsezylinder) erfolgte 1873 durch die "Grazer Waggon-, Maschinenbau- und Stahlwerks-Gesellschaft"; dabei wurden eine grössere, liegende Dampfmaschine und ein dritter Gebläsezylinder installiert sowie das Wasserrad entfernt. Seither blieb die Anlage - soweit heute feststellbar - ohne nennenswerte Veränderungen und vermittelt deshalb einen Eindruck von der älteren Hüttenmaschinentechnik.
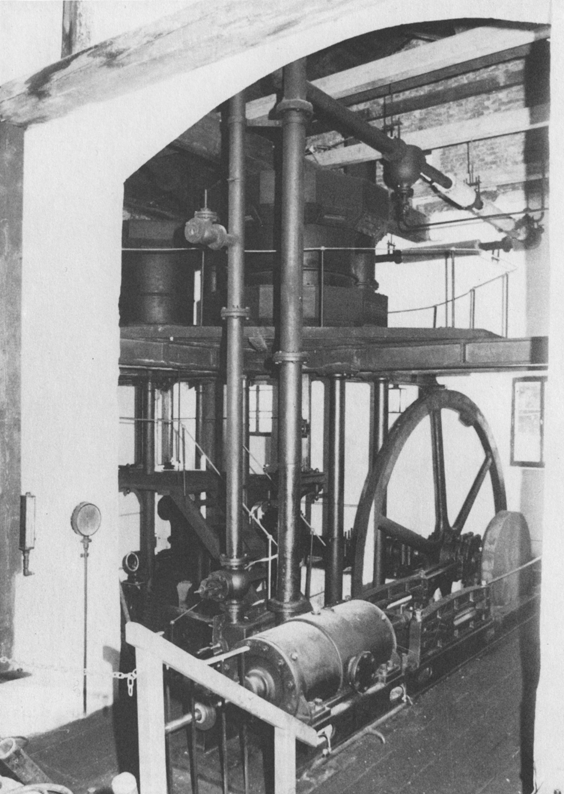
Im Jahre 1873 installierte Dampfmaschine des teilweise älteren Hochofengebläses beim Radwerk III.
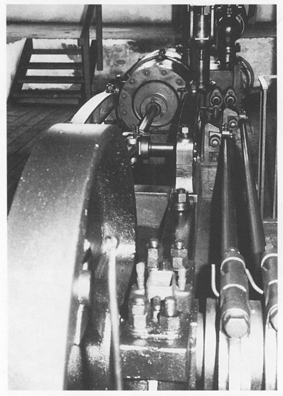
Bild links:Dampfmaschine des Gebläses
beim Radwerk III: hinten: liegender Zylinder,
rechts: Doppelschiebersteuerung.
Über eine Stiege gelangt man in den Maschinenraum, in dem zunächst die Dampfmaschine steht. Sie ist als doppeltwirkende Einzylindermaschine ("Rahmenmaschine") ausgeführt, die mit einer Doppelschiebesteuerung arbeitet. Der Kreuzkopf bewegt sich in einer Schlittenführung und überträgt die Kraft mittels Pleuelstange auf eine Kurbel, bei der es sich um eine Scheibe aus Gußeisen (1340 mm Durchmesser; 160 mm Dicke) handelt. Auf der zweifach gelagerten Kurbelwelle sitzen weiters zwei Exzenterscheiben zur Steuerung der Schieber, das Schwungrad und eine Hälfte der Kupplung. Das sechsarmige Schwungrad (Gußeisen) hat 4300 mm Aussendurchmesser und besteht aus zwei symmetrischen Hälften.
Die Fortsetzung der Kurbelwelle trägt sowohl die andere Kupplungshälfte als auch ein Ritzel (980 mm Aussendurchmesser), das ein Stirnrad (2800 mm Aussendurchmesser) auf der Kurbelwelle für die Gebläsezylinder antreibt. Die Kolben in den senkrechten Zylindern werden mittels schwingenden Kurbeltriebes bewegt, wobei die Kurbel des grossen Zylinders und jene des äusseren kleinen flach angeordnet sind.
| Bild rechts: Teil des Gebläses beim Radwerk III: Kupplung (links vorne), Ritzel (rechts) und Stirnrad (hinten). |
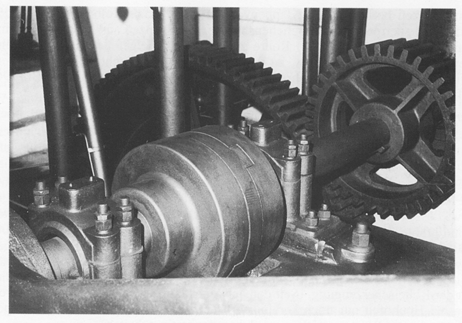 |
Eine Stiege neben der Dampfmaschine führt auf ein von gußeisernen Rägern gehaltenes Plateau, auf welchem die drei Windzylinder ruhen. In den achtechigen Kränzen befinden sich Klappenventile, die je nach Kolbenbewegung den Luftzutritt sperren oder ermöglichen; von diesen Kränzen aus strömte der Wind durch (teilweise jetzt noch erhaltene) Rohre zu einem Sammelgefäss (Windkessel) und weiter zum Winderhitzer bzw. zu den Blasformen des Hochofens. Der grössere Zylinder stammt aus dem Jahre 1873, während die beiden kleineren auf die Zeit des ersten Umbaues 1852/54 zurückgehen.
Die Gebläseanlage lässt sich mit einem Elektromotor zu Demonstrationszwecken in Bewegung setzen. Der Einbau dieses Antriebes erfolgte nach gründlicher Überholung aller Lager, Gelenke usw. nachdem die Maschine über sechs Jahrzehnte stillgestanden war.
An der Westseite des Gebläsehauses liegen zwei gußeiserne U-förmige Rohre ("Pfeifen") aus dem Winderhitzer. In diesem Apparat umspülte heißes Gichtgas bzw. dessen Abgas mehrere solcher Rohre, durch welche das Gebläse kalten Wind presste; bei Durchströmen der Rohre erwärmte sich der Wind auf ca. 400-500°C (rekuperative Erwärmung) und gelangte als Heißwind durch Leitungen bzw. Düsen und Blasformen in das Gestell des Hochofens. Die Windvorwärmung bewirkt eine merkbare Senkung des Holzkohlen- oder Koksverbrauches bei der Roheisenerzeugung. (Seit den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts werden bei Hochöfen nur noch keramisch besetzte Winderhitzer, System Cowper, gebaut, die mit Wärmespeicherung, d. h. regenerativ, arbeiten).
Ofenstock
Als zweiter noch vorhandener Teil des Radwerkes III steht südlich des Gebläsehauses der Ofenstock des ehemaligen Hochofens. Das aus Natursteinen erbaute, mit Mauerankern und Schließen armierte Rauhgemäuer umgab bis zum Umbau von 1873 das Mauerwerk des eigentlichen Ofens, wobei sich zwischen diesem und dem Ofenstock zur Aufnahme von Wärmedehnungen das "Futter", eine Füllung loser Steine, befand. Beim Umbau verlor das Rauhgemäuer seine Aufgabe, die Ofenzustellung zu stützen, denn im Ofenstock wurde konzentrisch ein freistehender Hochofen errichtet, so dass die massiven Aussenmauern nur noch Gichtaufbauten getragen haben. An dieser Konstruktion änderten auch einige Umbauten bis zur Stillegung nichts mehr.
Im 1984 restaurierten Ofenstock liegt auf dem Boden eine "Ofensau" mit ca. 3,9 m Durchmesser und ca. 1 m Höhe; sie bildet sich während eines mehrjährigen Schmelzbetriebes im unteren Bereich jedes Hochofens und setzt sich aus Roheisen, stahlartigen Teilen sowie Schlacke zusammen. Aus der Grösse der Ofensau lässt sich die Dimension des Hochofens an Gestell und Bodenstein ableiten. Ausserdem erkennt man an den örtlichen Vertiefungen die Lege der Blasformen und des (zum Vordernberger Bach gerichteten) Abstichloches.

Eine weitere Ofensau aus dem "Dreierwerk" befindet sich an der Nordseite des Radwerkes IV. Sie wurde zu Beginn des Ersten Weltkrieges dorthin transportiert, wobei man Holzrollen, massive Kanthölzer und Flaschenzüge benützt hat.
Neben dem Ofenstock stand ein kleiner Schmelzofen, in dem zu Demonstrationszwecken Eisen erzeugt werden konnte (Dieser Schmelzofen wurde ins Radwerk IV übertragen und dokumentiert die Anfänge des Eisenwesens in unserem Gebiet).